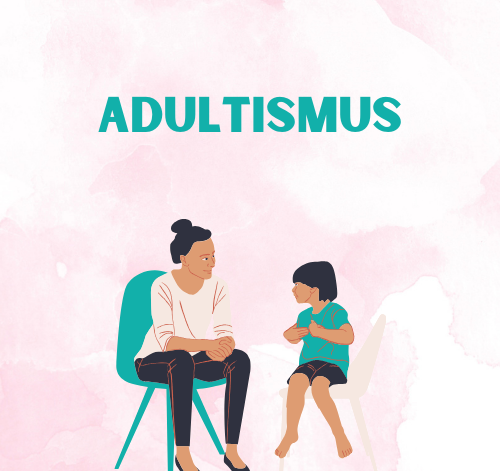Stell dir vor, du bist neun Jahre alt. Du hast gerade eine Idee, die dich begeistert – du möchtest einen kleinen Gemüsegarten im Hinterhof anlegen. Du erzählst es deinen Eltern, doch ihre Reaktion ist ernüchternd. „Das ist doch viel zu viel Arbeit für dich, das kannst du nicht, du bist viel zu jung“ sagen sie. „Konzentrier dich lieber auf deine Hausaufgaben, Schule ist wichtiger.“ Deine Begeisterung verpufft, und du fühlst dich missverstanden und klein gemacht.
Dieser Vorfall mag harmlos erscheinen, doch er ist ein Beispiel für Adultismus, eine Form der Diskriminierung, die oft unbemerkt bleibt. Wenn Erwachsene die Stimmen und Bedürfnisse von Kindern übergehen oder abtun, weil sie sie als weniger wichtig oder valide betrachten, hinterlässt das Spuren. Es gibt viele Situationen, in denen Kinder erleben, dass ihre Meinung weniger zählt, dass sie nicht ernst genommen werden oder dass Entscheidungen über ihre Köpfe hinweg getroffen werden.
Was ist Adultismus?
Adultismus ist eine Form der Diskriminierung und Unterdrückung, die auf dem Altersunterschied zwischen Erwachsenen und Kindern basiert. Es beschreibt die oft unbewusste Annahme, dass Erwachsene aufgrund ihres Alters überlegen sind und mehr Rechte haben als Kinder. Dies kann sich in der Art und Weise manifestieren, wie Erwachsene mit Kindern sprechen, wie sie deren Meinungen und Gefühle abtun und wie sie Entscheidungen für Kinder treffen, ohne deren Bedürfnisse und Wünsche zu berücksichtigen.
Adultismus kann weitreichende Auswirkungen auf das Selbstwertgefühl und die Entwicklung von Kindern haben. Sie lernen, dass ihre Stimme weniger wichtig ist, dass sie sich anpassen müssen und dass ihre Bedürfnisse hintangestellt werden. Dies kann zu einem Gefühl der Ohnmacht führen und das Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten untergraben.
Wie beeinflusst Adultismus unsere Kinder?
Die Auswirkungen von Adultismus auf Kinder sind vielfältig und oft tiefgreifend. Kinder, die regelmäßig adultistisches Verhalten erfahren, entwickeln möglicherweise:
1. Geringes Selbstwertgefühl: Wenn ihre Meinungen und Gefühle ständig abgewertet werden, beginnen sie zu glauben, dass sie wirklich weniger wert sind.
2. Angst vor dem Ausdrücken ihrer Meinung: Sie könnten sich zurückziehen und weniger bereit sein, ihre Gedanken und Gefühle zu teilen, aus Angst, abgewiesen oder nicht ernst genommen zu werden.
3. Abhängigkeit: Sie lernen, dass Erwachsene immer besser wissen, was richtig ist, und verlassen sich daher übermäßig auf sie, anstatt eigene Entscheidungen zu treffen.
4. Rebellisches Verhalten: Einige Kinder reagieren auf Adultismus mit Trotz und Widerstand, um ihre Autonomie und Selbstachtung zu verteidigen.
5. Eingeschränkte Problemlösungsfähigkeiten: Wenn ihnen selten die Möglichkeit gegeben wird, Probleme selbst zu lösen, entwickeln sie diese wichtigen Fähigkeiten nicht ausreichend.
Beispielsätze für adultistisches Verhalten im Alltag:
1. „Das verstehst du noch nicht, du bist zu jung.“
– Dieser Satz impliziert, dass das Kind aufgrund seines Alters nicht in der Lage ist, Themen zu verstehen.
2. „Sei nicht so empfindlich, das ist doch kein Grund zu weinen.“
– Hier werden die Gefühle des Kindes abgewertet und nicht ernst genommen.
3. „Wenn du erwachsen bist, kannst du das machen. Jetzt noch nicht.“
– Dies signalisiert dem Kind, dass seine Wünsche und Interessen erst dann relevant sind, wenn es älter ist.
5. „Mach einfach, was ich dir sage“
– Dieser Satz untergräbt die Autonomie und Entscheidungsfähigkeit des Kindes.
6. „Das ist eine erwachsene Angelegenheit, das verstehst du noch nicht“
– Kinder werden hier von wichtigen Diskussionen oder Entscheidungen ausgeschlossen.
7. „Du hast keine Ahnung.“
– Eine abwertende Aussage, die die Fähigkeiten des Kindes, die Realität zu verstehen, in Frage stellt.
8. „Du bist noch zu klein, um das zu verstehen.“
– Dieser Satz schließt das Kind von Gesprächen oder Entscheidungen aus, indem es seine intellektuellen Fähigkeiten aufgrund seines Alters abwertet.
9. „Das ist nichts für Kinder.“
– Dies verallgemeinert und beschränkt die Erfahrungen des Kindes, ohne seine individuellen Fähigkeiten oder Interessen zu berücksichtigen.
10. „Warum fragst du so viele Fragen? Das ist nervig.“
– Die natürliche Neugier des Kindes wird hier als störend dargestellt, was seine Bereitschaft, Fragen zu stellen und zu lernen, dämpfen kann.
11. „Du verstehst das nicht.“
– Eine abweisende Bemerkung, die das Kind von der aktuellen Diskussion ausschließt und ihm das Gefühl gibt, dass seine Meinung derzeit nicht relevant ist.
12. „Lass das, du machst es nur kaputt.“
– Dieser Satz unterstellt, dass das Kind nicht in der Lage ist, etwas richtig zu machen, und entmutigt es, neue Dinge auszuprobieren oder zu lernen.
13. „Iss das auf“
– Dieser Satz ist wohl ein Klassiker. Das Kind verlernt hierdurch auf sein Sättigungsgefühl zu hören.
14. „Stell dich nicht so an“
– es unterdrückt ein intrinsisches Gefühl von Kinder. Möglicherweise haben Kinder gerade Angst oder fühlen sich unwohl.
15. „Sei mal still“
– vielleicht hat das Kind gerade was Wichtiges mitzuteilen und fühlt sich nicht gesehen.
16. „Lauf anständig“
– was ist denn „anständig“?
Diese Sätze mögen auf den ersten Blick harmlos erscheinen, es ist tatsächlich völlig „normal“, dass manche Menschen so mit unseren Kinder sprechen.
Würden wir so mit Erwachsenen sprechen?
Die Beispielsätze tragen zur Verfestigung adultistischer Strukturen bei und vermitteln Kindern das Gefühl, dass ihre Beiträge und Gefühle weniger wichtig sind. Es ist wichtig, sich dieser Dynamiken bewusst zu werden und Wege zu finden, Kinder als gleichwertige Gesprächspartner zu behandeln. Denn nur so können wir ihnen den Raum geben, sich zu selbstbewussten und unabhängigen Menschen zu entwickeln.
Ich denke es ist an der Zeit umzudenken. Unsere Kinder sind unser höchstes Gut. Manchmal hilft es sich zu überlegen, wie ich mich als Kind fühlen würde.
Worte sind so machtvoll und können verletzten und einhemmen und gleichzeitig so viel Positives bewegen, also seid achtsam.
Um Adultismus zu verhindern, ist es wichtig, Kinder ernst zu nehmen und ihnen Respekt zu zeigen. Das fängt damit an, auf die eigene Sprache und das Verhalten zu achten. Erwachsene sollten Kinder wie gleichwertige Menschen behandeln, ihre Gefühle anerkennen und sie an Entscheidungen beteiligen, die sie betreffen. Wenn wir Empathie und Verständnis fördern, können wir eine Generation heranwachsen lassen, die sich gehört und wertgeschätzt fühlt. Das stärkt nicht nur das Selbstbewusstsein der Kinder, sondern auch eine respektvolle und gerechte Gesellschaft. Jeder kann dazu beitragen, indem wir die Meinungen und Erfahrungen der Kinder ernst nehmen und sie als vollwertige Mitglieder unserer Gemeinschaft sehen. So können wir die unsichtbaren Mauern des Adultismus abbauen und eine bessere Zukunft schaffen.